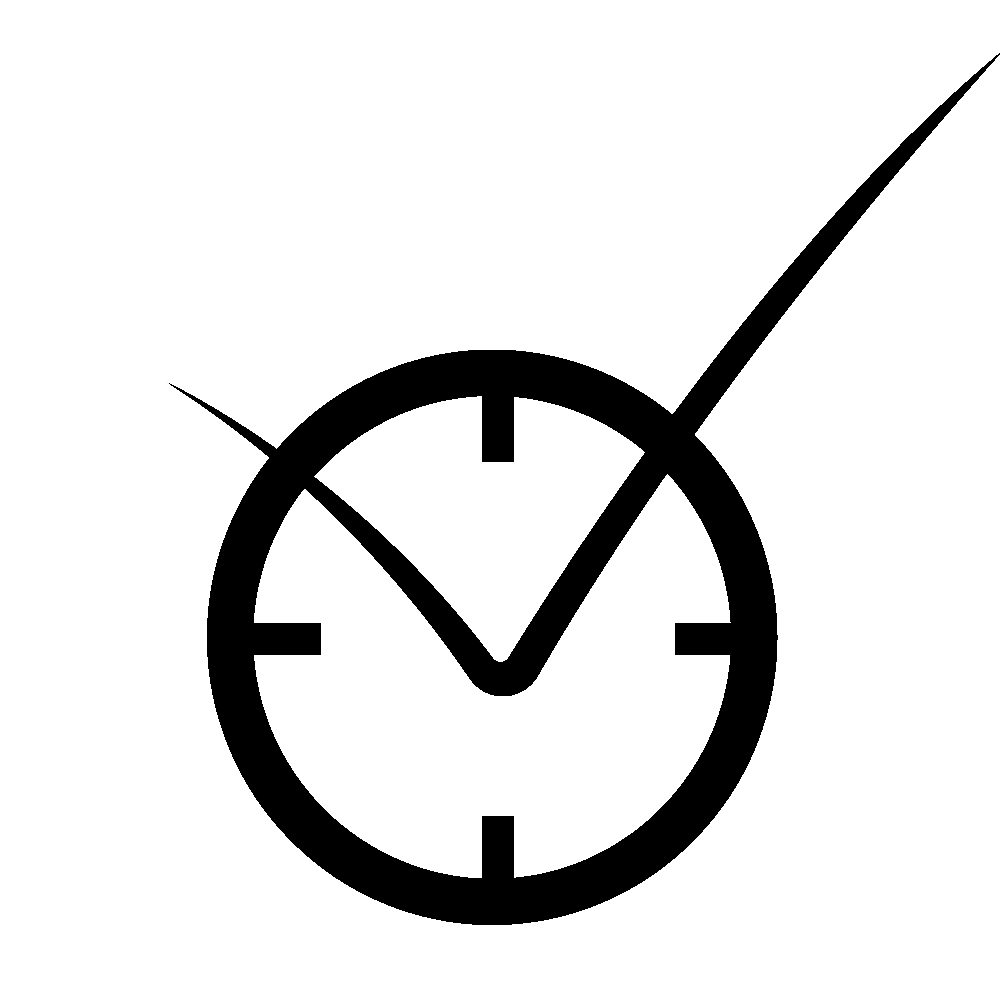Entwicklungsgerechte Mediennutzung in der Familie: Orientierung, Halt & erste Hilfe für eine gute Medienerziehung
Digitale Medien durchdringen unseren Alltag inzwischen so selbstverständlich, dass man oft vergisst, wie jung die digitale Welt eigentlich ist. Für viele Eltern fühlt es sich so an, als hätte sich die Realität ihrer Kinder über Nacht verändert: Smartphones in der Grundschule, soziale Netzwerke bereits in der vierten Klasse, Gaming-Communities, die wichtiger werden als „analoge“ Freundschaften, stundenlanges Scrollen, Bingewatching, ständige Erreichbarkeit.
Was früher Freizeit war, ist heute digital strukturiert. Wo früher Langeweile war, sind Unterhaltung und Ablenkung heute nur einen Klick entfernt. In diesem Wandel steckt für Kinder und Jugendliche nicht nur eine Chance, sondern auch eine enorme Herausforderung. Sie müssen lernen mit Reizen umzugehen, die selbst für Erwachsene schwer zu kontrollieren sind. Sie wachsen mit Geräten auf, die darauf optimiert sind, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln, ihre Gefühle anzusprechen und sie möglichst lange in der Nutzung festzuhalten.
Deshalb ist die entwicklungsgerechte Mediennutzung heute ein zentrales Erziehungsthema moderner Familien.
Lesedauer: ca. 13 Minuten
Ein notwendiger Blick auf Chancen – und auf Verantwortung
Bevor wir über Risiken sprechen, ist es wichtig, mit einem Missverständnis aufzuräumen: Digitale Medien sind nicht „das Problem“. Das Internet eröffnet Zugang zu Wissen, Kreativität, sozialer Teilhabe und Selbstentdeckung. Kinder und Jugendliche können online lernen, gestalten, programmieren, kommunizieren, sich ausdrücken und sich vernetzen. Viele digitale Räume fördern Humor, Selbstwirksamkeit und Identität. Ein Smartphone ist mehr als ein technisches Gerät – es ist Kamera, Kalender, Notizbuch, Studio, Büro, Navigationssystem, Inspirationsquelle, Sozialraum und Lernplattform.
Diese Perspektive ist wichtig, denn sonst verengen wir den Blick. Gleichzeitig braucht es die Klarheit, dass diese Chancen nicht automatisch genutzt werden — und dass Kinder nicht verantwortlich dafür sind, die Risiken einzuschätzen. Geräte sind nicht gefährlich, weil sie existieren, sondern weil Apps, Games und Plattformen bewusst so gestaltet sind, dass sie unsere Aufmerksamkeit binden und ein impulsives Nutzungsverhalten fördern. Sie sind Produkte einer Industrie, die davon lebt, dass wir freiwillig möglichst viel Lebenszeit und persönliche Daten in die Medien investieren. Das Hauptziel der Tech-Giganten? Möglichst viel Geld verdienen.
Letztlich sind wir alle Teil dieses profitorientierten Systems und treiben es sogar mit an. Solange wir die kostenlosen Plattformen und Angebote von Google, Meta, Microsoft & Co. nutzen, ohne zu hinterfragen ob das tatsächlich notwendig ist oder ob wir mit den oft rücksichtslosen Unternehmenspraktiken einverstanden sind, wird sich auch nichts ändern. Je früher wir Kinder und Jugendliche ganz selbstverständlich mit in dieses „Hamsterrad der Gemütlichkeit“ aufnehmen, umso schwieriger wird es für die kommenden Generationen sein, den Ausstieg zu finden. Jedes Kind und jeder Jugendliche, der im Internet unterwegs ist, sollte wissen wo der Notausgang ist oder zumindest, dass ein Ausgang existiert.
Das dafür notwendige Wissen zu vermitteln, liegt in unserer Verantwortung.
Warum wird entwicklungsgerechte Mediennutzung immer wichtiger?
Die neue Realität: Jugendliche verbringen fast eine komplette Arbeitswoche online
Viele Eltern ahnen, dass ihre Kinder viel Zeit am Bildschirm verbringen und verbringen selbst einige Zeit mit digitalen Medien – sei es für den Beruf oder in der Freizeit. Die Fremd- und Selbsteinschätzungen liegen oft unterhalb der tatsächlichen Nutzung.
Die Jugend-Digitalstudie 2024 hat ergeben, dass 16- bis 18-Jährige im Durchschnitt knapp 72 Stunden pro Woche online sind – das entspricht drei vollen Tagen ohne Pause. Dafür nutzen sie jede Woche fast 38 Stunden lang das Smartphone – das sind mindestens 5 Stunden pro Tag. Auch wenn die Beobachtung erfreulich ist, dass die Nutzungszeit zunehmend auf Bildungsangebote entfällt, bleibt festzuhalten, dass Jugendliche einen erheblichen Anteil des Tages online sind.
Zahlen wie jene der DAK-Studien verdeutlichen das Ausmaß: Etwa jedes vierte Kind nutzt Social Media riskant, rund sechs Prozent zeigen bereits Suchtkriterien. Hochgerechnet betrifft das Hunderttausende. Gleichzeitig berichten Jugendliche vom Gefühl, selbst dafür verantwortlich zu sein, Medienkompetenzen zu entwickeln DIVSI U25-Studie.
Je jünger die Kinder, desto bedenklicher die Wirkung: Das kindliche Gehirn passt sich an die ständige Reizüberflutung an. Belohnungserwartungen verändern sich, das Erinnerungsvermögen leidet und Aufmerksamkeitsspannen sind verkürzt. Das Gehirn lernt sogar Langeweile zu „antizipieren“ – Kinder greifen zum Handy, bevor sie sich überhaupt gelangweilt fühlen! „Du gehörst uns!“ (Christian Montag 2021)
Dass die DAK als erste Krankenkasse nun beschlossen hat bundesweit ein „Frühscreening zur Mediensucht“ als Teil der J1- und J2-Untersuchungen einzuführen, sollte jeden Befürworter einer grenzenlosen Mediennutzung für Kinder und Jugendliche aufhorchen lassen.
Medienerziehung: Wie können Regeln dabei helfen, eine entwicklungsgerechte Mediennutzung zu fördern?
Regeln sind kein Zeichen von Strenge, sondern von Fürsorge. Kinder brauchen Orientierung, und sie brauchen Erwachsene, die Entscheidungen treffen können, deren Konsequenzen sie selbst noch nicht überblicken. Viele Konflikte entstehen nicht, weil Kinder „zu viel wollen“, sondern weil Grenzen fehlen oder Risiken unklar sind. Die Ergebnisse der EXIF-Studie zeigen, dass ein Erziehungsstil nach dem Motto „Freiheit mit Grenzen“ für eine gesunde Medienerziehung essentiell ist. Die Studie weist darauf hin, dass medienerzieherische Aufklärung & Unterstützung, unbewältigte Entwicklungsaufgaben und familiäre Konflikte zentrale Problembereiche sind, die es zu bewältigen gilt.
In der Beratungspraxis zeigt sich immer wieder: Nicht die Mediennutzung an sich ist immer das Kernproblem. Denn die Lösung für „das Problem mit den Medien“ sind oft klare Strukturen, kindgerechte Begleitung und wertfreie Kommunikation auf Augenhöhe.
Deshalb beginnt Medienerziehung immer bei der eigenen Haltung:
Welche Werte sollen im Familienalltag gelten?
Welche Rolle spielen digitale Geräte im sozialen Gefüge?
Was soll mein Kind durch die Mediennutzung lernen?
Wie stehe ich selbst zu digitalen Medien und was möchte ich meinem Kind weitergeben?
4 Grundregeln für entwicklungsgerechte Mediennutzung im Familienalltag
Diese drei Regeln sollen eine Idee dazu vermitteln, wie mit einfachen Maßnahmen das Risiko eines problematischen Mediengebrauchs verringert werden kann – nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für die ganze Familie.
Natürlich gilt es das Kindesalter, den Entwicklungsstand und die eigenen häuslichen Umstände zu beachten. Nicht alles ist für jede Familie direkt realisierbar – kann jedoch Anreiz sein, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
1. Verzicht auf Geräte im Kinderzimmer
Das Kinderzimmer sollte ein Rückzugsort ohne fixe digitale Ablenkung bleiben, wie z.B. den eigenen PC, die Konsole oder einen eigenen Fernseher. Das ist wichtig für Schlafgewohnheiten, Erholung und die psychische Gesundheit.
Auch das Smartphone als Wecker ist problematisch – wer den ersten und letzten Blick des Tages auf das Smartphone richtet, stärkt die Gewohnheitsbildung im Gehirn und macht das Gerät zur Notwendigkeit.
2. Medienfreie Zeiten – gemeinsame Aktivitäten & kein Handy am Essenstisch
Medienfreie Zeiten wie gemeinsame Mahlzeiten, Familienrituale und medienfreie Aktivitäten stärken Bindung und Kommunikation. Sie erinnern daran, dass es Momente gibt, in denen Menschen wichtiger sind als Geräte. Gerade das gemeinsame Essen kann zu einem täglichen Anker werden, der Nähe schafft, Gespräche ermöglicht und Struktur gibt.
3. Absprachen und Vereinbarungen auf Augenhöhe
Wichtiger als Verbote sind gemeinsame Absprachen: Medienverträge, bewusst geplante Medienzeiten oder feste Orte, an denen Geräte (nicht) genutzt werden.
4. Hinschauen und begleiten sind das A und O
Die wichtigste Grundregel ist präsent zu bleiben und die Kinder nicht sich selbst zu überlassen. Eine unregulierte Mediennutzung ist einer der größten Risikofaktoren für die Entstehung von problematischer oder suchtartiger Mediennutzung.
Eltern sollten sich bewusst sein und erklären, warum sie Regeln setzen – das schafft Verständnis und Vertrauen statt Widerstand. Wenn Kinder wissen, dass Regeln nicht aus Angst und „Böswilligkeit“, sondern aus Liebe und Verantwortung entstehen, sind sie eher bereit, sie mitzutragen. Denn auch Kinder wollen sich in ihren Bedürfnissen gehört, verstanden und ernst genommen fühlen.
Entwicklungsgerechte Mediennutzung: Empfehlungen zu Nutzungszeiten nach Alter
Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) empfiehlt in den AWMF-Leitlinien Höchstgrenzen für Mediennutzungszeiten. Die sechs nach Alter gestaffelten Regeln sind eine gute Basis für eine entwicklungsgerechte Mediennutzung in Kindheit und Jugend.
Grundsätzlich gilt:
- In den ersten drei Lebensjahren möglichst bildschirmfrei
- Im Kindergartenalter kurze, gemeinsame Medienzeiten
- In der Grundschule allmählich wachsende, aber klar begrenzte Nutzung
- Bis zum 18. Lebensjahr gilt: Mediennutzung begleiten und im Zweifelsfall professionelle Hilfe aufsuchen!
Die AWMF empfiehlt folgende tägliche Höchstgrenzen für Mediennutzungszeiten:
- 0-3 Jahre: Bildschirmfrei!
- 3-6 Jahre: 30 Minuten in Begleitung eines Erwachsenen
- 6-9 Jahre: 30-45 Minuten in Begleitung eines Erwachsenen
- 9-12 Jahre: 45-60 Minuten als Freizeitbeschäftigung
- 12-16 Jahre: 2 Stunden als Freizeitbeschäftigung
- 16-18 Jahre: 2 Stunden als Freizeitbeschäftigung
Bei allem was wir darüber wissen wie manipulativ die Apps, Plattformen und Spiele sein können, gibt es sogar Überlegungen, die noch einen Schritt weiter gehen:
- Keine eigene Konsole oder PC vor 12 Jahren
- Kein eigenes Smartphone vor 14 Jahren
- Smartphone-Verbote in Kindergärten und Schulen
- Ein verbindliches Mindestalter für Soziale Netzwerke
- Geräte sollten so spät wie möglich eigene Gegenstände werden, damit sie nicht zu einem zentralen Identitätsanker werden
Medienkompetenz entsteht nicht durch frühe oder permanente Nutzung
Diese Empfehlungen wirken in einer digital geprägten Gesellschaft manchmal fast radikal, doch sie folgen einem einfachen Prinzip: Kinder sollten nicht schneller reifen müssen, als es ihr Gehirn kann. Medienkompetenz entsteht nicht durch frühe oder permanente Nutzung, sondern durch Begleitung, Reflexion und den Erwerb analoger Fähigkeiten, auf die sie zurückgreifen können.
Moderne digitale Medien sind darauf optimiert Bindung zu erzeugen und nutzen somit unser evolutionär bedingtes Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung aus. Es wäre unrealistisch zu glauben, dass Kinder diesen Mechanismen natürlich widerstehen können. Erwachsene tun es ja selbst häufig nicht.
Entwicklungsgerecht heißt nicht „weniger Medien“, sondern „Medien zu einem passenden Zeitpunkt“. Kinder brauchen reale Erfahrungen, bevor sie digitale einordnen können:
Sie müssen erst den eigenen Körper spüren, bevor sie Avatare erstellen.
Sie müssen erst reale Konflikte erleben, bevor sie virtuelle bewältigen.
Sie müssen echte Langeweile aushalten, um die eigene Kreativität und Gestaltungskraft entdecken zu können.
Sie müssen reale Freundschaften erfahren dürfen, um sich nicht in parasozialen Beziehungen mit Influencern oder pseudo-Beziehungen mit KI-Chatbots zu verlieren.
Tipps und Hinweise zur Umsetzung auf bildschirmfrei-bis-3.de
Warum Kinder fasziniert von digitalen Geräten sind – und wie wir damit umgehen sollten
Wenn Kinder oder Jugendliche den Wunsch nach einem eigenen Smartphone äußern, steckt selten das Gerät selbst dahinter. Vielmehr geht es um soziale Zugehörigkeit. Sie möchten nicht ausgeschlossen sein, wollen an Gesprächen teilnehmen, dazugehören, mitreden können. Das Bedürfnis nach Anschluss ist ein menschliches Grundbedürfnis – und heute spielt es sich zum großen Teil digital ab.
Wenn Eltern diesen Wunsch vorschnell als „Druck der Gruppe“ abtun, übersehen sie oft die emotionale Dimension dahinter. Wer dem Kind erklärt, dass es nicht um das Gerät an sich, sondern um Freundschaften geht, schafft Raum für Lösungen, die emotionale Kompetenzen fördern. Vielleicht gibt es Alternativen, Übergänge oder gemeinsame Nutzungszeiten, die das Bedürfnis abfedern und zugleich Sicherheit geben.
Wichtig ist, Kinder (und sich selbst!) immer wieder daran zu erinnern, dass das Smartphone nicht überlebenswichtig ist.
Zugleich muss die digitale Welt als realer sozialer Raum anerkannt werden. Im „digitalen sozialen Nahraum“ entdecken Kinder und Jugendliche Identitäten, Communities und Interessen, die ihnen im Alltag manchmal fehlen. Deshalb ist es so entscheidend, dass sie Erwachsene haben, die ihnen zuhören, wenn etwas online irritiert, verletzt oder belastet. Ein „komisches Gefühl“ ist oft der erste Hinweis, dass etwas Unterstützung braucht.
Medienerziehung und Kompetenz beginnt bei den Erwachsenen
Kinder lernen am Modell ihrer Eltern und anderer wichtiger Bezugspersonen. Wenn Eltern ständig das Smartphone in der Hand halten, obwohl sie Regeln setzen, entstehen Widersprüche. Wenn Erwachsene argumentieren, sie „bräuchten das für die Arbeit oder um Abzuschalten“, während Kinder „nur zocken oder sinnlos surfen“, entsteht ein Machtgefälle. Kleinkinder können dabei noch weniger Unterscheiden zwischen Notwendigkeit und bewusster Ausnahme. Dabei nutzen Erwachsene Geräte oft genauso impulsiv wie Kinder und Jugendliche – nur mit besseren Begründungen.
Die Reflexion der eigenen Medienbiografie ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Elternarbeit: Warum nutzen wir Medien so, wie wir es tun? Welche Rolle spielen sie in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unserer Entspannung?
Je bewusster und offener Eltern damit umgehen, desto leichter können sie ihren Kindern Orientierung geben.
Problematische Mediennutzung: Ist das schon Sucht oder noch Pubertät?
Eine zentrale Frage vieler Eltern, die in die Beratung kommen, ist, ob problematische Nutzung bereits Sucht oder schlicht pubertäres Verhalten ist.
Meine Erfahrung zeigt: Es ist oft eine Mischung. Jugendliche ziehen sich in dieser Phase stärker in Gleichaltrigenwelten zurück, suchen Autonomie, entziehen sich elterlicher Kontrolle. Digitale Medien bieten Räume dafür – und sind dabei hochintensiv belohnend. Gleichzeitig kompensieren viele Jugendliche Stress, Einsamkeit oder Überforderung mit digitalem Konsum. Das öffnet die Tür für problematische und exzessive Nutzung.
Ob eine Sucht vorliegt, erkennt man nicht an der Dauer oder Intensität der Nutzung allein. Entscheidender sind Suchtfaktoren, wie Kontrollverlust, die Verdrängung anderer Interessen, der Umgang mit Konsequenzen und der emotionale Zustand ohne Medien. Viele Jugendliche wissen gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, nicht stimuliert zu sein. Hier ist Begleitung zentral: nicht wertend, sondern unterstützend, nicht ängstlich, sondern klar.
Gesellschaftliche Entwicklungen, die wir ernst nehmen müssen
Digitale Medien sind nicht nur individuelle Werkzeuge, sondern gesellschaftliche Systeme. Viele Eltern berichten von einem Gefühl der Überforderung. Gleichzeitig beobachten Fachkräfte zunehmend Phänomene wie Cybermobbing, Cybergrooming oder den frühen Kontakt mit sexualisierten Inhalten – und das mittlerweile schon in der Grundschule. Auch emotionale Manipulation, politische Radikalisierung und extremisierende Inhalte häufen sich. All das erreicht Kinder lange bevor sie verstehen können, was sie dort sehen oder gelernt haben, wahr von falsch im Internet zu unterscheiden.
Familien müssen heute Probleme lösen, die nicht aus der Familie kommen. Deshalb braucht es stärker als früher Vernetzung: Gespräche zwischen Eltern, zwischen Schulen und Familien, zwischen pädagogischen Fachkräften und der Gemeinschaft. „Es braucht ein Dorf um ein Kind großzuziehen“ – dieser Satz ist heute aktueller denn je und darf wörtlich genommen werden.
Erfahrungen im direkten sozialen Umfeld stärken die Wahrnehmung der eigenen tatsächlichen Wirklichkeit. Das bietet Kindern und Jugendlichen halt in einer medialen Welt, die uns gerne und häufig mit den vermeintlich zunehmenden Gefahren und Schattenseiten des gesellschaftlichen Miteinanders konfrontiert. Denn Emotionalisierung erzeugt Klicks – Bedrohung, Ausgrenzung, Gewalt erzeugen Aufmerksamkeit und trüben mitunter den Blick auf die eigene tatsächliche Lebenswelt.
Entwicklungsgerechte Mediennutzung gemeinsam gestalten: bewusst statt impulsiv, reflektiert statt teilnahmslos
Es ist Zeit für einen Diskurswechsel!
Weg von der achselzuckenden Annahme, dass „Medien eben zum Alltag und zur Freizeit dazugehören“, hin zu einer selbstbestimmten Nutzung. Wer davon ausgeht, dass die aktuellen und kommenden Generationen „ohnehin süchtig werden“, der bekräftigt eine gesellschaftliche selbsterfüllende Prophezeiung, deren (Nicht-)Erfüllung wir jedoch alle mit beeinflussen.
Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen, anstatt sie immer weiter an digitale Medien abzugeben – nicht die Technik kontrolliert uns, sondern wir kontrollieren die Technik.
Kinder brauchen Erwachsene, die sich nicht in die Ohnmacht begeben und sich trauen zu hinterfragen: Warum nutzen wir Geräte? Wie nutzen wir sie? Und welche Rolle sollen sie in unserem Zusammenleben spielen?
Eine entwicklungsgerechte Mediennutzung darf ein Lernfeld sein, muss jedoch kein zentraler Aspekt der Entwicklung, des Lernens und Aufwachsens werden.
Kinder wollen verstanden werden, nicht kontrolliert. Sie wollen ernst genommen werden, nicht überwacht. Und sie wollen begleitet werden, nicht allein gelassen. Wenn wir ihnen zutrauen, mit uns gemeinsam Regeln zu entwickeln, stärken wir nicht nur Medienkompetenz, sondern Beziehung, Selbstvertrauen und Resilienz.
Kinder und Jugendliche sollten ein Recht auf medienfreie Freizeit, Erziehung und Bildung haben.
Fazit: Entwicklungsgerechte Mediennutzung durch präsente & bedürfnisorientierte Medienerziehung
Digitale Medien, smarte Geräte und technologischer Fortschritt sind weder gut noch schlecht. Sie sind mächtig, faszinierend und vereinnahmend – und deshalb brauchen Kinder Schutz, Begleitung und Orientierung.
Eine entwicklungsgerechte Medienerziehung berücksichtigt ihre Bedürfnisse, ihre Fähigkeiten und ihren Entwicklungsstand. Sie setzt Grenzen, ohne Chancen zu nehmen, und lässt Freiheit, ohne Risiken zu ignorieren. Vor allem aber lebt Medienerziehung davon, dass Erwachsene präsent bleiben – führen, anleiten, begleiten.
Extras als Download:
Gedankenspiel & Erklärbeispiel für Kinder
Eine Einladung zum Gedankenspiel: Das Smartphone als Person
Für manche Menschen, ist das Smartphone, die Lieblings-App oder die meistgenutzte Plattform schon mehr als nur Technik…
In meiner Arbeit fällt mir auf, dass die digitalen Medien mitunter so viel Raum im Denken und Handeln von Menschen einnehmen, dass man das Gefühl bekommen kann, es handele sich um eine reale Person.
Daher möchte ich zu einem Gedankenspiel einladen:
Stell Dir vor, das Smartphone wäre eine Person,
die immer und überall mit Dir zusammen sein will,
die alles über Dich erfahren möchte,
die ungefragt Deine Daten weitergibt,
die Zugriff auf alle nicht-jugendfreie Inhalte der Welt hat,
die Dich bewusst manipuliert,
die will, dass Du jede freie Minute mit ihr verbringst,
die verlangt, dass Du sofort auf sie reagierst,
die nicht will, dass Du sie abschaltest –
würdest Du mit ihr befreundet sein?
würdest Du Dein Kind mit ihr alleine lassen?
Verfasst von: Lucas Holz, Echtzeit: Psychosoziale Beratung
Kontakt: echtzeitberatung.de/kontakt ↗
Die „Chips & Schokolade“-Metapher: Ein Erklärbeispiel für Kinder
Die „Chips & Schokolade“-Metapher kann hilfreich sein, um Kindern zu erklären, warum zu viel Mediennutzung nicht gesund ist…
Tipps zur Umsetzung
- Je nach Präferenz kann die Chipstüte auch mit einer Tafel Schokolade oder einer anderen analogen Verlockung ersetzt werden – das Smartphone könnte auch die Konsole, der PC oder das Tablet sein
- Um die Metapher noch „greifbarer“ zu machen und damit das Verstehen zu erleichtern, können das entsprechende Gerät und die Süßigkeit nebeneinander gelegt und darauf gezeigt oder in die Hand genommen werden, wenn es in der Metapher genannt wird.
- Als Erinnerungsstütze oder zum Vorlesen kann die Metapher auch abgeschrieben oder ausgedruckt werden. Es geht jedoch mehr ums Prinzip als um alle Details – Eltern kennen Ihre Kinder am besten und erzählen daher automatisch die Teile der Metapher, die wichtig sind, damit die Botschaft bei ihrem Kind ankommt.
„Stell Dir vor das Smartphone ist wie eine Tüte Chips: Chips zu essen ist lecker und wenn man einmal angefangen hat zu essen, kann man oft nicht mehr damit aufhören, bis die ganze Tüte leer ist. So ähnlich ist es auch mit dem Smartphone: das Smartphone zu benutzen macht Spaß und oft will man gar nicht mehr aufhören. Denn sowohl die Chips als auch das Smartphone wollen sogar gegessen und benutzt werden – warum? Weil damit die Unternehmen, die Chips frittieren und Smartphones bauen, ihr Geld verdienen. Wenn wir weniger Chips essen, verdienen die Unternehmen weniger Geld – genauso wie, wenn weniger Menschen ein Smartphone kaufen und es weniger benutzt wird. Deshalb macht es Spaß das Smartphone zu benutzen und die Chips schmecken so gut, dass wir direkt noch eine zweite Tüte kaufen wollen, wenn die erste leer ist.
Im Unterschied zur Chipstüte wird das Smartphone nicht leerer – es gibt immer neue Inhalte zu entdecken, die Spiele kann man immer weiter spielen und nach einem Video kommt direkt das nächste. Das Smartphone ist wie eine Chipstüte, die niemals leer wird. (Findige Kinder werden hier vielleicht anmerken, dass „der Akku doch auch leer wird!“ – den kann man aber ganz einfach wieder aufladen, ohne aus dem Haus zu gehen!)
Wenn ich nur eine Tüte Chips esse ist das viel für einen Tag, aber auch mal in Ordnung – vor allem wenn ich davon noch etwas an Mama und Papa abgebe. Wenn ich aber gleich noch eine zweite und dritte Tüte aufmache und immer weiter esse, dann habe ich irgendwann Bauchschmerzen und muss aufhören. Vielleicht habe ich sogar schon nach der ersten Tüte oder nach der Hälfte Bauchschmerzen! Mit den Bauchschmerzen will mir mein Körper nämlich etwas sagen: „Es ist nicht gut für dich so viele Chips zu essen, obwohl sie so lecker sind!“.
Wenn ich jetzt am Smartphone spiele oder etwas schaue, kann es passieren, dass ich den ganzen Tag lang nichts anderes mache – ohne dass ich das bemerke! Ich bemerke erst abends, wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen, dass ich ganz müde bin oder vielleicht sogar noch ganz aufgedreht, so dass ich gar nicht einschlafen kann. Das sind auch Zeichen des Körpers, dass etwas zu viel war und mir nicht gut getan hat – genauso wie die Bauchschmerzen, wenn ich zu viel Chips esse. Weil ich so auf das Smartphone konzentriert war und die Tüte nicht zwischendurch mal leer geworden ist, hatte ich gar keine Chance zu bemerken, dass mein Körper mir vielleicht schon viel früher zeigen wollte, dass das Spielen oder Schauen mir nicht gut tut. Mein Körper hatte ja gar keine Zeit mir zu zeigen, dass er eine Pause braucht, weil ich selbst gar keine machen konnte. Das Smartphone ist da nämlich ganz gerissen, denn es findet das gut, wenn Du den ganzen Tag mit ihm verbringst, selbst dann, wenn es Dir eigentlich nicht gut tut. Es fordert uns immer auf noch mehr zu Spielen, zu schauen und zu entdecken, anstatt uns auch mal eine Pause zu gönnen. Es will uns ganz und gar für sich haben und immer überall dabei sein. Die Chipstüte macht das nicht – die liegt im Schrank, klingelt und vibriert nicht.
Deshalb musst Du gut auf Dich aufpassen, wenn Du das Smartphone benutzt: Mach nur das, was Du dir vorgenommen hast, mache Pausen zwischendurch und stell Dir einen Wecker – ich helfe Dir auch gerne dabei.
Ich weiß nämlich selbst nur zu gut, wie viel Spaß das Smartphone macht und wie gerissen es ist – Ich muss genauso auf mich aufpassen wie Du!
Vielleicht passen wir ab jetzt einfach aufeinander auf – Du sagst mir und ich sage Dir, wenn das Smartphone uns mal wieder zu sehr im Griff hat!
Was hältst Du davon?“
Verfasst von: Lucas Holz, Echtzeit: Psychosoziale Beratung
Kontakt: echtzeitberatung.de/kontakt ↗